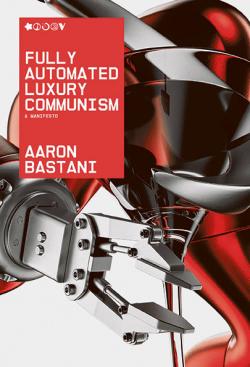Julian Duschek
[Aus Anlass der bevorstehenden Veröffentlichung von Heft 7 des Distanz-Magazins veröffentlichen wir hier einen bereits in Heft 6 abgedruckten Beitrag. Die vorliegende Untersuchung stellt den Beginn einer Artikelreihe dar, welche im neuen Heft fortgeführt wird.]
Seit 2020 ist Social Distancing in aller Munde. Um eine weitere Ausbreitung der Pandemie zu verhindern, sollen die Menschen voneinander Abstand halten. Ob der Begriff geeignet ist, Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung zu bezeichnen, ist nicht die Frage des vorliegenden Textes. Stattdessen soll hier eine alternative Deutung gewagt und der gesellschaftstheoretische Gehalt des Begriffs ausgebreitet werden. Denn Social Distancing drückt auch ein Grundmotiv bürgerlicher Vergesellschaftung aus, das sich mit Adorno (2019) als „intrinsisch antagonistischer Charakter“ gesellschaftlicher Totalität fassen lässt (ebd. S. 53): Wie der Begriff sozialer Distanz genaugenommen eine contradictio in adiecto ist – das ‚Soziale‘ hebt auf das Gesellige, miteinander Verbundene ab, ‚Distanz‘ dagegen referiert auf Trennung und Vereinzelung –, so erhält sich der gesellschaftliche Zusammenhang paradoxerweise durch die widerstreitenden Beziehungen der einzelnen Subjekte. M. a. W. reproduziert sich das Kapital als gesellschaftliches Verhältnis durch Vereinzelung und Konkurrenz: durch soziale Distanz.
In einer zentralen Hinsicht widerspricht das physische Abstandhalten diesem bürgerlich-kapitalistischen Imperativ ‚sozialer Distanzierung‘. Denn während das eine einen Akt der Solidarität mit denen darstellt, die zu Risikogruppen gehören, drücken sich im anderen Gleichgültigkeit und soziale Kälte aus (vgl. Adorno 2016, S. 687). Kein Wunder also, dass jene, die sich mit dem herrschenden Allgemeinen bewusstlos identifizieren, sich derzeit mit solcher Wut und Empörung dagegen wehren, Mindestabstände einzuhalten, Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen oder sich impfen zu lassen. Um der eigenen sozialatomistischen Freiheit willen nehmen sie die Gefährdung Angehöriger von Risikogruppen nicht nur in Kauf, sondern forcieren diese. Auch Regierungen von Ländern wie Schweden, Großbritannien, Brasilien oder den USA verzichteten lange Zeit auf Maßnahmen zum Schutze von Risikogruppen, um im Sinne ‚sozialer Distanzierung‘ den gewöhnlichen Betrieb aufrechtzuerhalten und die Bevölkerung zu ‚durchseuchen‘. Hier wie dort erscheint offen die sozialdarwinistische Logik des survival of the fittest, die für den Imperativ ‚sozialer Distanzierung‘ besonders im Neoliberalismus charakteristisch ist (vgl. Stapelfeldt 2012, S. 352).
Damit diese Feststellung nicht bloße Kulturkritik bleibt, soll im Folgenden die Grundlage dafür geschaffen werden, sie gesellschaftsgeschichtlich und ‑theoretisch zu reflektieren und zu rekonstruieren. Dafür wird zunächst exemplarisch anhand der Lehre Friedrich Hayeks (1899–1992) ‚Social Distancing‘ als zentrales Strukturmerkmal des Neoliberalismus bestimmt und dabei seine sozialdarwinistische Logik entwickelt. Die Argumentation mündet im Begriff des Kriegs aller gegen alle, weshalb die Darstellung schließlich vom Neoliberalismus zurück in den Merkantilismus springt: jener Epoche, in der Thomas Hobbes (1588–1679) einen barbarischen Naturzustand konstruierte und die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft sich im Prozess „ursprünglicher Akkumulation“ (Marx) sukzessive durchsetzte. Durch die Konfrontation des logischen Gehalts des Begriffs vom bellum omnium contra omnes mit seinem historischen Erfahrungshintergrund können seine ideologischen Gehalte kritisiert und sein spezifischer Zeitkern beleuchtet werden. Darin besteht die Grundlage der historischen Rekonstruktion der Bedeutung des ‚Social Distancing‘ in der neoliberalen Gegenwart. Der vorliegende Text versteht sich daher lediglich als Auftakt einer Reihe von Untersuchungen, die den historisch-spezifischen Strukturwandel des bellum zum Gegenstand haben.
1. Neoliberale Ordnung und Sozialdarwinismus
Die Basisinstitution des Neoliberalismus besteht laut Hayek (1980) in der „spontanen Ordnung“ des Marktes (ebd. S. 70; vgl. S. 57–79). Ihr spontaner Charakter verweist darauf, dass sie das Produkt eines evolutionären Fortschrittsprozesses, ein „Ergebnis anpassender Entwicklung“ sei (Hayek 1991, S. 72). Diese Entwicklung lasse sich aufgrund ihres „experimentellen Charakter[s]“ nicht rational planen, sondern bestehe in einem ungelenkten und kumulativen, „organische[n], langsame[n], halb unbewußte[n] Wachstum“ (ebd. S. 47, S. 69). Im Verlauf dieses evolutionären Entwicklungsprozesses entscheiden laut Hayek die zweckmäßigsten Anpassungsstrategien an gesellschaftliche Umweltbedingungen darüber, welche Personen und Verhaltensweisen sich gegen andere durchsetzen können. Vorausgesetzt ist der zur Natur verdinglichte Konkurrenzkampf, dem sich die Einzelnen anzupassen haben: Der Imperativ ‚sozialer Distanzierung‘ ist total. Die kompetitive Vereinzelung hat also aus „freiwillige[r] Konformität“ zum herrschenden Allgemeinen zu erfolgen (ebd. S. 78).
Fortschritt vollziehe sich durch „selektive Ausmerzung“ und dadurch, „daß die Einzelnen die Erfolgreicheren nachahmen und daß sie von Zeichen und Symbolen geleitet werden, wie den Preisen, die für ihre Erzeugnisse geboten werden“ (ebd. S. 34, S. 37). Existenzberechtigt sind daher nur jene Anpassungs- und Verhaltensweisen, die sich als zweckmäßig erweisen, indem sie „sich im Wettbewerb mit anderen Prinzipien, denen andere Individuen und Gruppen folgen, bewähren“ (ebd. S. 46; vgl. S. 34–37, S. 73f.). Wer und was dagegen im Konkurrenzkampf unterliegt, wird ‚ausgemerzt‘. Das zweckrationale Anpassungshandeln der Vereinzelten folgt daher der Logik der Selbsterhaltung – das irrationale Verhältnis des Kampfes zwischen ihnen reproduziert sich in der andauernden Unterscheidung von Stärke und Schwäche, Konformismus und Nonkonformismus, Freund und Feind, Beute und Gefahr. Den sozialdarwinistischen Charakter dieser Forderungen verschleiert Hayek mit dem Hinweis, dass
„in der sozialen Entwicklung […] der entscheidende Faktor nicht die Auswahl der physischen und vererblichen Eigenschaften der Individuen [ist], sondern die Auswahl durch Nachahmung der erfolgreichen Institutionen und Bräuche. Obwohl auch hier die Wirkungsweise der Erfolg von Individuen oder Gruppen ist, so sind das Entwicklungsergebnis nicht vererbliche Eigenschaften der Individuen, sondern Anschauungen und Fertigkeiten, kurz gesagt, das ganze kulturelle Erbe, das durch Lernen und Nachahmung weitergegeben wird“ (ebd. S. 74).
Das permanente Umschlagen dieses auf Verhaltens- und Anpassungsstrategien abhebenden Selektionsmechanismus in einen physisch-biologischen drückt sich gerade während der Corona-Krise darin aus, dass die Beschränkungen zum Schutze der Leben von Risikopatienten ein Hemmnis für den ‚Fortschritt‘ im Neoliberalismus darstellen.[1] Nicht nur unter Extrembedingungen kommen im neoliberalen Fortschritt zuerst die Verwundbarsten unter die Räder. So besteht die neoliberale Ordnung aus einem kontinuierlichen nach sozialdarwinistischem Muster ablaufenden Konkurrenz-und Überlebens-Kampf –ein bellum omnium contra omnes: der Inbegriff ‚sozialer Distanzierung‘.
Ebenso wie der Hobbessche Naturzustand macht auch die ‚spontane Ordnung‘ einen starken Staat notwendig, soll sie sich nicht selbst zerstören. In der Staatsgewalt sieht Hayek (1980) die „wesentliche Bedingung für die Erhaltung jener Gesamtordnung“ (ebd. S. 71). Der häufig kolportierte neoliberale Antietatismus relativiert sich vor dem Hintergrund des enormen Ausmaßes staatlichen Handelns.
„[D]as Wichtigste“ sei nach Hayek (1991) „die Art und nicht das Ausmaß der Staatstätigkeit. […] [E]ine Regierung, die verhältnismäßig inaktiv ist, aber das falsche macht, [kann] die Kräfte des Marktes weit mehr lähmen als eine Regierung, die sich um Wirtschaftsangelegenheiten mehr kümmert, sich aber auf Maßnahmen beschränkt, die die spontanen Kräfte der Wirtschaft unterstützen“ (ebd. S. 287).
Es käme darauf an, „ein dauerndes gesetzliches Rahmenwerk“ zu schaffen, in welchem „der Einzelne mit einem gewissen Vertrauen planen kann und die menschliche Unsicherheit so gering wie möglich wird“ (ebd.; vgl. S. 28). Mit anderen Worten: Der Staat hat eine Rahmenordnung zu schaffen, innerhalb derer die Vereinzelten ungestört durch zweckrationales Anpassungshandeln ihr Überleben gegen alle anderen sichern können – innerhalb derer der bellum omnium contra omnes toben kann (vgl. ebd. S. 46). Dem entspricht, dass sich die spontane Marktordnung historisch nicht wie von selbst durch ‚organisches Wachstum‘ durchsetzte, sondern durch (supra-)staatliche administrative De-Regulierungsmaßnahmen implementiert wurde. Dem entspricht auch, dass der Staat die autodestruktiven Tendenzen des bellum re-regulativ beschneidet, um ihn in Funktion zu halten: Während der Lockdown die pandemische Katastrophe verhindert, die bei ungestörtem ‚Normalbetrieb‘ eintreten würde, sollen die wirtschaftlichen Hilfspakete den dadurch verschärften Konkurrenzdruck mildern und massenhafte Pleiten verhindern. Insofern ist laut Stapelfeldt (2012) „die ‚spontane Ordnung‘: ‚gemacht‘“ (ebd. S. 349). Der neoliberale Staat habe „das Ganze zu konstituieren“ und sei daher „so omnipotent wie nie zuvor ein ökonomischer Staat“ (Stapelfeldt 2014, S. 590).
Diese neoliberale Konstellation von Staat und Markt findet eine weitere Entsprechung im Hobbesschen Werk. Da der bellum als gesellschaftlicher Naturzustand gesetzt und in der einzelmenschlichen Natur begründet ist, verschwindet er nicht einfach durch die Gewalt des Souveräns. Stattdessen wurde der Leviathan gegründet, „um die politischen Bedingungen zu schaffen, unter denen sich das Macht- und Erwerbsstreben der einzelnen in zivilen Formen abspielen kann“ (Euchner 1973, S. 26). Der Hobbessche Staat hat also auch ein gesetzliches Rahmenwerk zu schaffen, innerhalb dessen sich die autodestruktiven Tendenzen des bellum nicht voll entfalten. Der bellum reproduziert sich darüber hinaus im Verhältnis zwischen den Staaten (vgl. Stapelfeldt 2006, S. 251). Die Auseinandersetzung mit dem Hobbesschen Werk und insbesondere dem Begriff des bellum scheint vor diesem Hintergrund einen Beitrag für eine Kritik des Neoliberalismus leisten zu können
Dass Hobbes mit dem Begriff des bellum „die hervorstechenden Züge der bürgerlichen Konkurrenzgesellschaft erkannt und seiner Konstruktion zugrunde gelegt hat“ (Fetscher 1998, S. LVII), ist mittlerweile Usus. Dabei ist die Behauptung, der Begriff träfe heute noch etwas, höchst voraussetzungsvoll. Nicht zuletzt liegen zwischen dem Zeitpunkt seiner Bestimmung und der gesellschaftlichen Gegenwart über 350 Jahre. Die Voraussetzungen lassen sich auch nicht – wie es zuweilen in der Hobbes-Forschung geschieht – durch individualisierende Zuschreibungen einholen, die die Klarsichtigkeit und den Mut des Hobbesschen Genies hervorheben. Um seinem kritischen Erkenntnispotential für die neoliberale Gesellschaft zur Geltung zu verhelfen, muss stattdessen zunächst der logische Gehalt des Begriffes mit der besonderen historischen Situation, in der er entstand, konfrontiert werden, um ihn kritisieren zu können und seinen spezifischen Zeitkern zu identifizieren. Dies soll im Folgenden unternommen werden.
2. Der Begriff des bellum omnium contra omnes
Hobbes setzt den Naturzustand des bellum omnium contra omnes als einen, in dem es keine „die Menschen im Zaum haltende Macht“ gibt, „die dazu in der Lage ist, sie alle einzuschüchtern“ (Hobbes 1998, S. 96; S. 95). Demnach beschreibt er einen vor-staatlichen und keinen im modernen Sinne des Wortes[2] vor-gesellschaftlichen Zustand – schließlich ist der Krieg selbst ein gesellschaftliches Verhältnis. Die logische Abstraktion von der allgemeinen Staatsgewalt ist die grundlegende Prämisse des Gedankenexperiments und scheint es Hobbes zu erlauben, eine „Schlußfolgerung aus den Leidenschaften“ der Menschen für ihr Zusammenleben zu ziehen (ebd. S. 96). Davon ausgehend, dass die Menschen von Natur aus „hinsichtlich ihrer körperlichen und geistigen Fähigkeiten […] gleich geschaffen“ seien, schließt Hobbes auf „eine Gleichheit der Hoffnung, unsere Absichten erreichen zu können“ (ebd. S. 94f.). Die Gleichheit der Fähigkeiten und die der Hoffnungen impliziert die der Chancen. Zu dieser setzt Hobbes sodann die naturrechtliche individuelle Freiheit eines jeden, „seine eigene Macht nach seinem Willen zur Erhaltung […] seines eigenen Lebens […] einzusetzen und folglich alles zu tun, was er nach […] eigener Vernunft als das zu diesem Zweck geeignete Mittel ansieht“ (ebd. S. 99). Daraus folgt,
„daß in einem solchen Zustand jedermann ein Recht auf alles hat, selbst auf den Körper eines anderen. Und deshalb kann niemand sicher sein, solange dieses Recht eines jeden auf alles besteht, die Zeit über zu leben, die die Natur dem Menschen gewöhnlich einräumt, wie stark und klug er auch sein mag“ (ebd.)
Gleichheit und Freiheit konstituieren einen Konkurrenzkampf: „Und wenn daher zwei Menschen nach demselben Gegenstand streben, den sie jedoch nicht zusammen genießen können, so werden sie Feinde und sind […] bestrebt, sich gegenseitig zu vernichten oder zu unterwerfen“ (ebd. S. 94f.). Dieser Kampf ist gleichbedeutend mit dem Zustand, „der Krieg genannt wird, und zwar […] Krieg eines jeden gegen jeden“ (ebd. S. 96). Auch für solche, „die an sich gerne innerhalb bescheidener Grenzen ein behagliches Leben führen würden“, ist dieser Krieg zwingend, weil es nach Hobbes immer „einige gibt, denen es Vergnügen bereitet, sich an ihrer Macht zu weiden, indem sie auf Eroberungen ausgehen, die sie über das zu ihrer Sicherheit erforderliche Maß hinaustreiben“ – die sonst Friedfertigen sind dadurch ebenso genötigt, „durch Angriff ihre Macht“ zu mehren, da sie sich im Angesicht der wölfischen Aggressivität ihrer Mitmenschen „durch bloße Verteidigung unmöglich lange halten“ können (ebd. S. 95).
In diesem Zustand ständiger Unsicherheit schlagen Freiheit und Gleichheit in Ungleichheit und Unfreiheit um. Im bellum herrscht „beständige Furcht und Gefahr eines gewaltsamen Todes – das menschliche Leben ist einsam, armselig, ekelhaft, tierisch und kurz“ (ebd. S. 96). Im Naturzustand gibt es kein Gesetz und weder „Eigentum noch Herrschaft, noch ein bestimmtes Mein und Dein“ – jedem gehört nur das, „was er erlangen kann, und zwar so lange, wie er es zu behaupten vermag“ (ebd. S. 98; vgl. S. 190). So unterliegt „alles […] dem Wettbewerb“ (Hobbes 2010, S. 216).
Die allgemeine Konkurrenz stellt das zentrale Moment des bellum dar und verweist zugleich auf dessen autodestruktive Irrationalität. Der Wettbewerb zeitigt für Hobbes keine produktiven und fortschrittlichen Konsequenzen, wie sie ihm später im Liberalismus zugeschrieben werden; im Gegenteil ist in
„einer solchen Lage […] für Fleiß kein Raum, da man sich seiner Früchte nicht sicher sein kann; und folglich gibt es keinen Ackerbau, keine Schiffahrt, keine Waren, die auf dem Seeweg eingeführt werden können, keine bequemen Gebäude, keine Geräte, um Dinge, deren Fortbewegung viel Kraft erfordert, hin- und herzubewegen, keine Kenntnis von der Erdoberfläche, keine Zeitrechnung“ (Hobbes 1998, S. 96).
Aufgrund des elenden Lebens, das alle Menschen im Naturzustand zu führen gezwungen sind, gebieten ihnen zunächst ihre Leidenschaften, schließlich auch die Vernunft, den bellum zu befrieden. „Die Leidenschaften, die die Menschen friedfertig machen, sind Todesfurcht, das Verlangen nach Dingen, die zu einem angenehmen Leben notwendig sind[,] und die Hoffnung, sie durch Fleiß erlangen zu können“ (ebd. S. 98). Da dies laut Hobbes für alle gilt, gebietet die Vernunft schließlich den intersubjektiven Verzicht aller auf ihr ‚Recht auf alles‘. Durch einen gemeinsamen rationalen Gesellschafts-Vertrag verpflichten sich schließlich alle dazu, einen Teil ihrer Freiheit und ihrer Macht einem Souverän zu übertragen (vgl. ebd. S. 99f.). Der so konstituierte Leviathan hat durch die Macht des Schwertes für allgemeinen Frieden und Sicherheit im Innern zu sorgen (vgl. ebd. S. 101f.; 191).
Der bellum ist dadurch nicht verschwunden, seine Wurzeln leben in der wölfischen Natur des Menschen fort. Und weil ebendieses „unausrottbare Machtstreben der einzelnen den Staat ständig bedroht, kann die Souveränität nicht geteilt werden“ (Euchner 1973, S. 25). So bedarf, nach Hobbes die Irrationalität des bürgerlichen Naturzustands der Rationalität eines absolutistischen Staates, soll jener nicht an seinen Widersprüchen zugrunde gehen. Hobbes’ Betonung der Notwendigkeit ungeteilter absoluter Souveränität stellte eine Absage an den revolutionären Konstitutionalismus seiner Zeit dar. Ohne die Teilung der Macht habe es laut Hobbes nicht zu jenem Bürgerkrieg kommen können, welcher den besonderen historischen Erfahrungshintergrund seines Werkes darstellt (vgl. Hobbes 1991, S. 126).
3. Historischer Erfahrungshintergrund des bellum
Der besondere historische Erfahrungshintergrund des Hobbesschen Begriffs des bellum omnium contra omnes ist der der ersten englischen bürgerlichen Revolution (1642–1649), welche sich gegen die absolutistischen Bestrebungen Charles I. richtete, auf die Etablierung des Konstitutionalismus zielte und die in der zeitweiligen Abschaffung der Monarchie und der Ausrufung der Republik gipfelte. Die Wirren des englischen Bürgerkrieges inspirierten ohne Zweifel jene Konstruktion des chaotischen Naturzustands, die 1651 veröffentlicht wurde. Sie kamen durch politische, nationale, religiöse und ökonomische Frontstellungen zustande, die sich gegenseitig immer wieder überlagerten: Es kämpften die Royalisten gegen das House of Commons, Schotten, Iren und Waliser gegen Engländer, Katholiken gegen Protestanten, Presbyterianer gegen Independenten, die Leveller gegen die neuen und alten Eliten usw. (vgl. Haan/Niedhard 2016, S. 168–182). Über ein Jahrzehnt herrschte in England Bürgerkrieg statt eines Souveräns – in Hobbes’ Worten: Behemoth statt Leviathan. „[M]an kann die Lebensweise, die dort, wo keine allgemeine Gewalt zu fürchten ist, herrschen würde, aus der Lebensweise ersehen, in die solche Menschen, die früher unter einer friedlichen Regierung gelebt hatten, in einen Bürgerkrieg abzusinken pflegen“ (Hobbes 1998, S 97). Hobbes selbst verbrachte das Jahrzehnt im Exil, zumeist am Hofe von Maria Henriette von Frankreich, Schwester von Ludwig XIV. und Gemahlin von Charles I. (vgl. Münkler 1993, S. 32).
Obgleich es kaum möglich ist, „die Erfahrung des Bürgerkriegs für sein Denken zu überschätzen“ (Münkler 1991, S. 224), stellte dieser lediglich den unmittelbaren Anlass für den Begriff des bellum dar. Denn schon vor der Erfahrung des Bürgerkriegsjahrzehnts schrieb Hobbes (1959): „Der Mensch ist ein Wolf für den Menschen“ (ebd. S. 59). Als der allgemeine historische Erfahrungshintergrund des Begriffs muss der Übergang von der alten feudalen zur neuen bürgerlichen Ordnung angesehen werden. Dieser Übergang, in welchem die bürgerliche Revolution katalysatorisch wirkte, hatte seine Anfänge in England bereits mehrere Jahrhunderte zuvor.
Politisch vollzog sich die Auflösung des englischen Feudalsystems mit der Implementierung eines absolutistischen Zentralstaats im 16. Jh., wodurch die Macht des Feudaladels drastisch beschränkt wurde. Es entstand ein rationaler Absolutismus, welcher das aufstrebende Bürgertum religiös und politisch zu unterdrücken trachtete, ökonomisch von diesem jedoch abhängig war. Dadurch entwickelte sich eine relative Machtstellung der neuen Bourgeoisie, die sich in der Institution des House of Commons politisch vergegenständlichte (vgl. Haan/Niedhardt 2016, S. 121). Der Widerspruch zwischen Unterdrückung und Abhängigkeit führte schließlich sowohl zum Versuch der Implementierung eines Willkür-Absolutismus durch Charles I. als auch zu dessen Scheitern: Von 1629 bis 1640 regierte er als Alleinherrscher mit einem radikal anti-bürgerlichen Programm, ohne das House of Commons einzuberufen. Im Krieg gegen die Schotten sah sich der Monarch jedoch gezwungen, das Parlament wieder einzuberufen, um finanzielle Hilfe zu erhalten. Weil das Parlament seine Unterstützung an unerhörte Mitbestimmungs- und Freiheitsforderungen knüpfte, löste es Charles jedoch nach drei Wochen wieder auf. Dies evozierte Unruhen, die den Anfang des englischen Bürgerkriegs markierten. Der Niedergang der alten Ordnung vollzog sich demnach politisch in der Transformation des Feudalismus in einen Absolutismus und schließlich in der Krise desselben: Der König wurde im Zuge der ersten englischen bürgerlichen Revolution zunächst aus dem Land gejagt und später – am 30. Januar 1649 – hingerichtet. Vier Monate später wurde England zur Republik ausgerufen (vgl. ebd. S. 167–188). Dieser folgte die Diktatur Cromwells, dann 1660 die Restauration und schließlich die zweite englische bürgerliche Revolution 1688–89, welche die erste in wesentlichen Punkten bestätigte und eine konstitutionelle Monarchie implementierte (vgl. Hill 1977, S. 136).
Ökonomisch begann die Auflösung des englischen Feudalsystems noch vor dessen politischer Erosion, wurde durch diese jedoch wesentlich beschleunigt. So wurden seit dem 13. Jh. sukzessive die Binnenzölle abgeschafft, wodurch die Entstehung nationaler Märkte begünstigt wurde (vgl. Stapelfeldt 2006, S. 67). In der zweiten Hälfte des 14. Jh. war die Leibeigenschaft bereits vollkommen verschwunden. „Die ungeheure Mehrzahl der Bevölkerung bestand damals und noch mehr im 15. Jahrhundert aus freien, selbstwirtschaftenden Bauern“ (Marx 1965, S. 744f.). Durch die enclosures ab dem 15. Jh. – die Einhegung von Gemeindeland zum Zwecke privater, warenförmiger Viehzucht vor allem für den Export – wurde vielen Menschen die Subsistenzgrundlage entzogen. Häufig wurden sie nicht nur ihres Ackerlandes beraubt, sondern auch von ihren Wohn- und Arbeitsstätten vertrieben. Massenweise Verelendung der ehemals leibeigenen Bevölkerung war die Folge (vgl. Haan/Niedhardt 2016, S. 82–86).
Unmittelbaren Anstoß für diese Entwicklung gab „das Aufblühn der flandrischen Wollmanufaktur und das entsprechende Steigen der Wollpreise“ (Marx 1965, S. 746), m. a. W. die mit der Integration Englands in den damals von den Niederlanden dominierten Weltmarkt einhergehende steigende Bedeutung der Wollproduktion für den Export. Die enclosures führten dazu, dass die Landbevölkerung „sich massenhaft in Bettler, Räuber, Vagabunden“ verwandelte (ebd. S. 762). Eine weitere Konsequenz waren Landflucht und Verstädterung, denn viele waren gezwungen, sich für ihren Lebensunterhalt in den städtischen Manufakturen zu verdingen. So entstand das städtische Proletariat (vgl. Haan/Niedhardt 2016, S. 73).[3]
Die Lohnarbeitenden waren im traditionellen Sinne unfrei: Durch die „Blutgesetzgebung“ ab dem 16. Jh. wurden die Enteigneten, Vagabundierenden und Pauperisierten zur Arbeit gewaltsam gezwungen, den Erfordernissen des Manufakturbetriebs entsprechend diszipliniert, durch Vereinigungs- und Zunftverbote atomisiert und ihr Arbeitslohn systematisch herabgedrückt (Vgl. Marx 1965, S. 761; vgl. ebd. S. 761–770). Die Gewalt, welche das Elend dieser Menschen bedingte, war politisch und physisch und nicht abstrakt-ökonomisch (vgl. Gerstenberger 2018, S. 73–78).
Gewinner und sozialer Träger dieser Entwicklung war das neue Bürgertum, namentlich die Gentry, der niedere Land-Adel, der sich durch die enclosures zu einer Klasse von Großgrundbesitzern und agrarischen Kapitalisten entwickelte, weiterhin die Handelskapitalisten, welche von diesen Produktionsrationalisierungen profitierten, und schließlich die Manufakturisten, welche von der gewaltsamen Belebung des Arbeitsmarktes profitierten (vgl. Haan/Niedhardt 2016, S. 85–107). Aus diesen drei Gruppen speiste sich maßgeblich das House of Commons – sie waren, bei aller Uneinigkeit untereinander, auch die maßgeblichen Subjekte der ersten englischen bürgerlichen Revolution (vgl. ebd. S. 177–182). In dieser entluden und beschleunigten sich die skizzierten politisch-ökonomischen Entwicklungen. Ziel war die Implementierung eines merkantilistischen Staats, welcher das Recht auf Privateigentum garantierte, eine Handels- und Zollpolitik verwirklichte, die den Außenhandel begünstigte und die absolutistische Willkürherrschaft beendete, indem die Verwaltung rationalisiert und der Souverän der Verfassung untergeordnet wurde, welcher also m. a. W. der Durchsetzung von Verhältnissen freier Konkurrenz den Weg bereitete (vgl. Stapelfeldt 2006, S. 91f.).[4]
Der besondere wie allgemeine Erfahrungshintergrund des Hobbesschen Begriffs des bellum omnium contra omnes ist demnach die „sogen. ursprüngliche Akkumulation“ (Marx 1965, S. 766). In ihrem Verlauf konstituierte sich die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft. Die erste englische bürgerliche Revolution bildete den vorläufigen Höhepunkt dieser Entwicklungen, wodurch dieselben entscheidend beschleunigt wurden. Zu Hobbes Zeiten war die Scheidung von Produzierenden und Produktionsmitteln bereits fortgeschritten. Maßgebliche gesellschaftliche Gruppen waren entweder proletarisiert oder bourgeois. Es existierte bereits ein Arbeitsmarkt und ein Binnenmarkt vor allem für Agrarwaren – die Subsistenzökonomie war dagegen am Verschwinden (vgl. Haan/Niedhardt 2016, S. 29–36, 70f., 82). England war im Weltmarkt integriert und sollte diesen bald dominieren. Freilich war die bewusstlose Herrschaft des Kapitals noch nicht durchgesetzt und die Entwicklung vom Handels- zum Industriekapitalismus noch nicht vollzogen. Die später durch die kapitalistischen Verhältnisse vermittelte und von den bürgerlichen Subjekten inkorporierte Gewalt befand sich damals noch im Stadium roher Unmittelbarkeit und Äußerlichkeit (vgl. Marx 1965, S. 779).[5] Sowohl Handels-, Manufaktur- als auch Agrarkapital befanden sich jedoch auf dem Vormarsch und waren bereits stark genug, einem König, dessen Politik den neuen Notwendigkeiten der Kapitalakkumulation widersprach, den Prozess zu machen und ihm den Kopf abzuschlagen. Mit Marx (1967) lässt sich das so fassen, dass das „hinreichend erstarkte Kapital“ im Laufe der ursprünglichen Akkumulation die historischen Schranken der alten Gesellschaft niederriss, welche „die ihm adäquate Verkehrsweise […] genierten und hemmten“ (ebd, S. 543). Während die historischen Schranken u. a. in „Zunftzwang, Regierungsmaßregelung, innren Zöllen“ bestanden[6], bezeichnet die adäquate Verkehrsweise des Kapitals den„Zusammenstoß der entfesselten, nur durch ihre eigenen Interessen bestimmten Individuen“ (ebd. S. 542, 543). Das Konkurrenzprinzip – oder wie man ironischerweise heute auch sagen könnte: ‚social distancing‘ – war demnach bereits in einem Maße entwickelt und implementiert, dass Hobbes seine maßgeblichen Momente in seiner Naturzustandskonstruktion integrieren und als autodestruktiv-irrational kritisieren konnte.
4. Kritik des bellum
Die Hobbessche Naturzustandskonstruktion intendierte eine Kritik der im Zuge ursprünglicher Akkumulation und bürgerlicher Revolution aufkommenden bürgerlich-kapitalistischen Tendenzen. Im Begriff des bellum omnium contra omnes wird der merkantilistische Zusammenhang von Konkurrenz, Gewalt und autodestruktiver Irrationalität kritisch zugespitzt: Er macht die Restitution absoluter Souveränität notwendig. Es scheint daher zunächst, dass die Hobbessche Kritik voll und ganz auf dem Standpunkt des Alten stehe und sich gegen den Übergang zum Neuen stemme. So lehnte Hobbes die aufstrebende und aufbegehrende Handelsbourgeoisie in den englischen Städten ab und wandte sich gegen die Idee des Individualismus, welche bspw. als Gewissensfreiheit durch die Independenten gepredigt wurde (vgl. Fetscher 1998, S. XLIV; Münkler 1991, S. 236). Insofern wäre eine Kritik des Neoliberalismus, welche sich der Hobbesschen Begrifflichkeiten blindlings bedient, rückwärtsgewandt und veraltet. Im Folgenden soll jedoch dargelegt werden, dass zentrale Momente der Hobbesschen Kritik sich bereits auf dem Standpunkt des Neuen befanden und insofern der bürgerlichen Ideologie verhaftet waren. Durch die Kritik dieser Anteile kann das kritische Erkenntnispotential des Begriffs vom bellum freigelegt werden.
Zunächst stellt die rationalistische Lehre vom Gesellschaftsvertrag eine Abkehr von der metaphysischen Idee des Gottesgnadentums des Monarchen dar (auch wenn das Aufgehen der Untertanen im Leviathan noch immer metaphysische Momente beinhaltet): Der Staat wird aus der bürgerlichen Gesellschaft (resp. Naturzustand) hergeleitet und nicht andersherum. Vor allem aber ging Hobbes von impliziten, teils bewusstlosen sozialen Vorannahmen aus, durch welche er der neuen Ordnung bei aller Kritik verhaftet blieb:
So hat Macpherson (1973) zeigen können, dass Hobbes in seiner der Naturzustandskonstruktion zugrunde liegenden ‚Schlußfolgerung aus den Leidenschaften‘ nicht wie vorgegeben von der Natur des natürlichen Menschen, sondern von der Natur des gesellschaftlichen Menschen ausging:
„Sein Naturzustand ist eine Feststellung über das Betragen, das […] Menschen, die in zivilisierten Gesellschaften leben und die Bedürfnisse zivilisierter Wesen haben, an den Tag legen würden, wenn niemand mehr die Einhaltung von Gesetz und Vertrag […] erzwingen würde. Um zum Naturzustand zu gelangen, schob Hobbes das Gesetz beiseite, nicht jedoch die gesellschaftlich erworbenen Verhaltensweisen und Begierden der Menschen“ (ebd. S. 35).
Konkurrenz, Misstrauen und Ruhmsucht – nach Hobbes die wesentlichen Streitursachen in der menschlichen Natur, charakterisieren Macpherson zufolge nicht nur den Naturzustand: Es „sind die Faktoren der gegenwärtigen bürgerlichen Gesellschaft, die sie in den Zustand der Rohheit zurückwerfen würden, gäbe es keine allgemein anerkannte Autorität“ (ebd. S. 38; vgl. Hobbes 1998, S. 95f.). Das grenzenlose Machtstreben der sich im Naturzustand befindlichen Subjekte entspricht nicht mehr „traditionellen Gebrauchswert-Bedürfnissen“, sondern bereits „kapitalistischen Tauschwert-Bedürfnissen“ (Stapelfeldt 2006, S. 208). Nur unter der Voraussetzung, dass jeder zweckrational – „von seiner eigenen Vernunft angeleitet“ – seine egoistischen Ziele verfolgt, ist das allgemeine Konkurrenzverhältnis des Naturzustands zu denken (Hobbes 1998, S. 99).
Darüber hinaus bedarf es nach Hobbes voneinander isolierte eigennützige Subjekte, die die Verbindung des Vertrages und des Tausches eingehen und dadurch den Naturzustand verlassen können:
„Immer wenn jemand sein Recht überträgt oder darauf verzichtet, so tut er dies entweder in der Erwägung, daß im Gegenzug ein Recht auf ihn übertragen werde, oder weil er dadurch ein anderes Gut zu erlangen hofft. Denn es handelt sich um eine willentliche Handlung, und Gegenstand der willentlichen Handlungen jedes Menschen ist ein Gut für ihn selbst“ (ebd. S. 101).
Mit dieser Vorstellung korrespondiert die Hobbessche Bestimmung der naturrechtlichen Freiheit der Einzelnen als „Abwesenheit äußerer Hindernisse“ (Hobbes 1998, S. 99). Da eine solche Charakterisierung wesentlich auf der Trennung der Menschen und nicht auf ihrer Verbindung beruht, handelt es sich mit Marx (1976) gesprochen „um die Freiheit des Menschen als isolierter auf sich zurückgezogener Monade“ (ebd. S. 364). Ein solches Recht der Freiheit sei „das Recht dieser Absonderung, das Recht des beschränkten, auf sich beschränkten Individuums. Die praktische Nutzanwendung […] der Freiheit ist das […] Privateigentum […]“ (ebd. S. 364). Entsprechend wies auch Hobbes’ Begriff des Eigentums bereits bürgerliche Züge auf. Als Privates war es zumindest den Mitmenschen gegenüber exklusiv: „[D]as Eigentum eines Untertans an seinem Boden“ bestehe in dem „Recht […], alle anderen Untertanen von dessen Benutzung auszuschließen“ (Hobbes 1998, S. 191).[7] Es ist demnach das Recht, „ohne Beziehung auf andre Menschen, unabhängig von der Gesellschaft, sein Vermögen zu genießen und über dasselbe zu disponieren, das Recht des Eigennutzes“ (Marx 1976, S. 364). Sowohl Privateigentum als auch individuelle Freiheit – deren Einheit im Besitzindividualismus des 17. Jh. bestand – können laut Hobbes im Naturzustand nicht dauerhaft existieren; erst der Leviathan vermag sie zu sichern (vgl. Macpherson 1973, S. 295–304).
Hobbes setzte also implizit „vereinzelte Einzelne“ voraus (Marx 1967, S. 6). Doch indem er deren spezifische Charakteristika als anthropologische Naturkonstanten setzt, abstrahiert er von ihrer grundlegend gesellschaftlichen Konstitution – davon, dass „vereinzelte Einzelne […] nur in der Gesellschaft sich vereinzeln“ können (ebd.). Zwar impliziert der Begriff des bellum den Zwang zur Vereinzelung, doch erscheint dieser selbst lediglich als Konsequenz der wölfischen Natur des Menschen und nicht als Voraussetzung der Vereinzelung. Nicht ohne Grund beginnt das Werk Leviathan, welches Hobbes als logisches System von aufeinanderfolgenden Deduktionen abgefasst hat, mit der Natur des Menschen. Mit dieser Individualisierung gesellschaftlicher Verhältnisse stand Hobbes bereits auf dem Standpunkt bürgerlicher Ideologie.
Hobbes’ ambivalent erscheinendes Verhältnis zur neuen Ordnung ist Ausdruck der gesellschaftlichen Situation des Übergangs, in der neue und alte Kräfte zeitgleich wirken, mal in Widerspruch und mal in Harmonie zueinander stehen. Diese eigentümliche Konstellation führt dazu, dass die Hobbessche Kritik nicht nur nicht radikal ausfällt, sondern sogar in Apologie umschlägt: in die Verdinglichung des bürgerlichen Konkurrenzverhältnisses zu einem– wenn auch hypothetischen – Naturzustand, der auch durch die Herrschaft des Leviathans nicht verschwindet. So hat Hobbes eine politische Theorie der „autoritäre[n] Herrschaft über das Bürgertum zu dessen Gunsten“ (Euchner 1973, S. 28) formuliert. Im Behemoth formulierte Hobbes 1668 in Bezug auf das aufbegehrende Bürgertum der Städte:
„ich betrachte den größten Teil der reichen Leute […] als Menschen, die auf nichts anderes als auf ihren augenblicklichen Nutzen sehen […]. Wenn sie verstanden hätten, von wie großem Wert es gewesen wäre, ihr Wohl in Gehorsam gegenüber ihrem gesetzmäßigen Herrscher zu wahren, hätten sie sich nie auf die Seite des Parlaments geschlagen, und so wäre es nie nötig gewesen, zu den Waffen zu greifen“ (Hobbes 1991, S. 142).
Es ist jedoch auch diese Situation des Übergangs, in der das Neue noch unverhüllt zutage tritt. Und hierin liegen Aktualität und Erkenntnispotential des Begriffs des bellum begründet. Reduziert „man Hobbes’ universellen Anspruch auf ein historisches Maß“ (Macpherson 1973, S. 25) und geht also davon aus, dass es der bellum ist, der die Menschen zu Wölfen macht, und nicht umgekehrt ihre wölfische Natur den bellum konstituiert, so lässt sich der kritische Gehalt des Begriffes retten. Er verweist dann zunächst auf den grundlegenden Antagonismus der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, vor dessen Hintergrund sich notwendig die Frage nach ihrer paradoxen Einheit stellt. Gleichzeitig bringt er ihr paradigmatisches Gewaltverhältnis auf den Begriff, indem er historisch Zeugnis von der ursprünglichen Akkumulation ablegt und logisch das Fortleben der Gewalt in dieser Gesellschaft darstellt. Weiterhin beschreibt er die gesellschaftliche Irrationalität bei gleichzeitiger Zweckrationalität der Teile, welche immer wieder in Irrationalität umzuschlagen droht. Die kompetitive Freiheit der Einzelnen schlägt im bellum in kollektive Unfreiheit um: Analog sind auch nach Marx (1967) nicht „die Individuen […] frei gesetzt in der freien Konkurrenz; sondern das Kapital ist frei gesetzt“ (ebd. S. 544).
Diese freie Konkurrenz, welche das Wesen des bellum ausmacht, ist begrifflich schließlich „nichts als die innre Natur des Kapitals, seine wesentliche Bestimmung, erscheinend und realisiert als Wechselwirkung der vielen Kapitalien aufeinander, die innre Tendenz als äußerliche Notwendigkeit“ (ebd. S. 317). Der bellum omnium contra omnes lässt sich daher charakterisieren als die bewusstlose Vermittlung der besonderen Einzelnen mit- und gegeneinander, durch welche das Kapitalverhältnis als allgemeines Gesetz gesetzt wird (vgl. ebd. S. 559). So bezeichnet der bellum das grundlegende Prinzip bürgerlich-kapitalistischer Vergesellschaftung: das irrationale Gewaltverhältnis zwischen vereinzelten Einzelnen, welche zueinander in Konkurrenz stehen, indem sie ihre antagonistischen Privatinteressen verfolgen. Dieses kritische Erkenntnispotenzial des Begriffs lässt sich auch für die Analyse der neoliberalen Gegenwart nutzen, deren ‚spontane Ordnung‘ durch die Vermittlung ‚sozialer Distanzierung‘ entsteht. Seine einfache Subsumtion auf heutige Verhältnisse wäre jedoch ahistorisch. Um ihr zu Aktualität zu verhelfen, bedarf es daher zunächst – zum Abschluss dieses Beitrages – der Reflexion auf den spezifischen Zeitkern der Hobbesschen Kritik.
5. Zeitkern des bellum
Einerseits gleicht der bellum omnium contra omnes „dem Modell einer perfekten Konkurrenzgesellschaft“ (Euchner 1973, S. 25). Andererseits vermengt der Begriff „zwei Zustände miteinander […]: den der […] Konkurrenz […] und den rohen Zustand des Krieges“ (Macpherson 1973, S. 42). Der bellum ist Inbegriff spontaner Unordnung vermittels ‚sozialer Distanzierung‘. In diesem unmittelbaren Zusammenhang von Konkurrenz, Gewalt und Irrationalität verweist der Hobbessche Naturzustandsbegriff auf die politisch-ökonomische Wirklichkeit des Merkantilismus. Hierin liegt seine historische Wahrheit – sein Zeitkern (vgl. Horkheimer/Adorno 2008, S. IX).
Der Zusammenhang von Gewalt und Konkurrenz spiegelt sich nirgends so deutlich wider wie in der aggressiven Handelspolitik des merkantilistischen Englands[8], welche zunächst unter Cromwell (1653–1658) implementiert, in der Restauration in wesentlichen Punkten übernommen und schließlich von Wilhelm III. (1689–1702) und dem älteren Pitt (1756–1761; 1766–1768) erneuert wurde. Ihre bevorzugten Mittel waren kriegerische Auseinandersetzungen, Piraterie, Seeblockaden und Protektionismus, wodurch die führende Stellung Englands im Weltwirtschaftssystem begründet wurde (vgl. Hill 1977, S. 124–135). Die britische Politik zeichnete sich im 18. Jh. „durch systematische Aggressivität aus“ (Hobsbawm 1972, S.–48). Im Jahr, in dem der Leviathan veröffentlicht wurde (1651), trat auch die erste Navigationsakte in Kraft. Sie ermöglichte England eine einheitliche nationale Kolonialpolitik und legte fest, daß der Handel mit den englischen Kolonien englischen Schiffen vorbehalten bleiben sollte. Dadurch sollte der von den Niederlanden dominierte Zwischenhandel ausgeschaltet werden. Dem folgte der erste Englisch-Niederländische Seekrieg 1652–54, in dessen Folge die Niederlande das englische Handelsmonopol mit seinen Kolonien anerkennen mussten. Die Navigationsakte und weitere Seekriege brachen in der zweiten Hälfte des 17. Jh. die niederländische Vormachtstellung im Welthandel. Nachdem die Niederlande geschlagen waren, richtete sich die englische Außen- und Handelspolitik gegen den neuen Hauptkonkurrenten Frankreich. In den fünf großen Kriegen des 18. Jh., an denen England teilnahm, – dem Spanischen (1701–14) und dem Österreichischen Erbfolgekrieg (1740–48), dem Siebenjährigen (1756–63) und dem Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg (1776–83) sowie den Revolutions- und Napoleonischen Kriegen (1793–1815) – „befand sich Großbritannien nur in einem einzigen eindeutig in der Defensive“ (Hobsbawm 1972, S. 48; vgl. ebd. S. 47–51).
Die außerökonomische Gewalt richtete sich also sowohl gegen konkurrierende Handelsnationen wie die Niederlande, Frankreich, Spanien oder Portugal als auch, wie oben dargelegt, gegen das entstehende Proletariat. Darüber hinaus war sie integraler Bestandteil der Kolonialherrschaft, welche ein weiteres „Hauptmoment […] der ursprünglichen Akkumulation“ darstellte (Marx 1965, S. 779). Die Kaufleute und ihre Handelsgesellschaften, allen voran die Eastindia Company, verdienten in den Kolonien „mit Methoden Geld […], die von Plünderung und Piraterie kaum zu unterscheiden waren“ (Hill 1977, S. 128). Im Dreiecks- und Sklavenhandel erfuhr der Zusammenhang von roher Gewalt und Profitstreben eine weitere Intensivierung:
„[D]ie Sklaven wurden mit britischen Exporten gekauft und auf britischen Schiffen transportiert. […] Sklaven konnten auf den westindischen Inseln für das fünffache dessen verkauft werden, was sie an der afrikanischen Küste kosteten. Daher brauchten sich die Sklavenhändler über Transportverluste (bis zu 20 Prozent) [sic!], die sich unter den katastrophalen Zuständen auf den Sklavenschiffen nicht vermeiden ließen, auch keine besonderen Sorgen zu machen“ (ebd. S. 183f.).
Das irrationale Moment der Epoche des Merkantilismus und sein Zusammenhang zu Gewalt und Konkurrenz begründet sich im merkantilistischen Dogma des ungleichen Tausches. Dieses bestimmte die Sphäre des Außenhandels, in welchem das primäre Mittel nationaler Bereicherung bestand. Die restriktive Zoll- und Kolonialpolitik sorgte für eine aktive Handelsbilanz, indem fast ausschließlich (unbearbeitete) koloniale Rohstoffe importiert und vor allem (bearbeitete) Manufakturwaren exportiert wurden – die Wertdifferenzen ließen sich die Händler zumeist in kolonialen Edelmetallen auszahlen. Das „zentrale Medium der merkantilistischen Bereicherung“ funktionierte demnach auf Kosten vorbürgerlicher Regionen; der ungleiche Tausch implizierte eine ungleiche Entwicklung (Stapelfeldt 2006, S. 165).
Eine analoge Spaltung existierte innerhalb der englischen Nationalökonomie selbst: auf der einen Seite die Sphäre der Zirkulation, des Handels und der ökonomischen Bereicherung, auf der anderen Seite die Sphäre der Produktion, der Ausbeutung durch außerökonomische Gewalt für den Export. Die Produktion war Anhängsel des Außenhandels: Produziert wurde zu möglichst geringen Kosten vor allem für den Export. Damit verbunden war das merkantilistische Dogma, dass „die Löhne […] so niedrig wie möglich gehalten werden [müssten]“ (Hill 1977, S. 209). Daraus folgte die politisch-administrative Festsetzung von Maximallöhnen durch Friedensrichter, was ebenfalls ein Verhältnis ungleichen Tausches implizierte: zwischen unfreien Lohnarbeitenden und freien Besitzenden.
Die handelskapitalistische Ökonomie stellte demnach einen Zusammenhang dar, welcher nicht aus sich selbst heraus Reichtum hervorzubringen vermochte: Einerseits lagen die Quellen des Reichtums außerhalb des Systems – in den Rohstoffen der weltgesellschaftlichen Peripherie der Kolonien und in der Arbeitskraft von unfreien Lohnarbeitenden und Versklavten. Andererseits war die Form der Aneignung dieses Reichtums außerökonomische und meist rohe Gewalt – in der Manufaktur, in den Kolonien, auf hoher See und auf den Sklavenmärkten und -plantagen. So war die merkantilistische Politik-Ökonomie nicht in der Lage, sich selbst zu reproduzieren. Indem systematischer Raubbau an den Quellen des Reichtums betrieben wurde, war sie autodestruktiv-irrational. Darin bestand die Notwendigkeit der politischen Integration des merkantilistischen bellum durch den Leviathan: Der Staat hatte immer neue Quellen des Reichtums zu erschließen und die Kontrolle über die bereits Erschlossenen auszuweiten.
Diese Strategie stieß im 18. Jh. an ihre Grenzen, da sie die inneren Widersprüche der Epoche lediglich verdrängte. Ebendiese führten schließlich zur Liberalisierung des bellum: zum scheinbaren Auseinandertreten von Gewalt, Irrationalität und Konkurrenz. Im Liberalismus erschien der bellum als ‚fair play‘, wodurch er sich vom Primat des Staates emanzipieren und zum Motor gesellschaftlichen Fortschritts avancieren konnte. In den folgenden Epochen des Imperialismus und des Staatsinterventionismus erschien der bellum dann sukzessive als verdinglichte Natur von Mensch und Gesellschaft.
Damit ist bereits der Ausblick auf eine Rekonstruktion des historisch-spezifischen Strukturwandels des bellum gegeben, die über den Merkantilismus hinausgeht. Ihr Ziel ist die erinnernde Bestimmung des Kampfs ums Dasein, der im Neoliberalismus allgegenwärtig geworden zu sein scheint. Sie geht von einem Fortdauern der irrationalen Gewaltgeschichte in der Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft aus und beleuchtet zunächst die wechselnden Konstellationen von Gewalt, Irrationalität und Konkurrenz und schließlich das Verhältnis zwischen bellum und Staat. Sie soll Gegenstand weiterer Untersuchungen sein – Fortsetzung folgt.
6. Literatur
Adorno (2019). Bemerkungen zu ‚The Authoritarian Personality‘ und weitere Texte. Berlin: Suhrkamp.
Adorno (2016) Erziehung nach Auschwitz. In: ders. Gesammelte Schriften. Band 10.2 (6. Auflage). Frankfurt am Main: Suhrkamp. S. 674–690.
Euchner, Walter (1973). Egoismus und Gemeinwohl. Studien zur Geschichte der bürgerlichen Philosophie. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Fetscher, Iring (1998). Einleitung. In: Hobbes, Thomas (1998): Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen und bürgerlichen Staates. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S.IX–LXVI
Gerstenberger, Heide (2018). Markt und Gewalt. Die Funktionsweise des historischen Kapitalismus. Münster: Westfälisches Dampfboot.
Haan, Heiner/Niedhart, Gottfried (2016). Geschichte Englands vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. München: C. H. Beck.
Hayek, Friedrich A. von (1991). Die Verfassung der Freiheit. Tübingen: Mohr.
Hayek, Friedrich A. von (1980). Recht, Gesetzgebung und Freiheit. Band 1: Regeln und Ordnung. München: mi-Verlag Moderne Industrie.
Hill, Christopher (1977). Von der Reformation zur Industriellen Revolution. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Englands 1530–1780. Frankfurt am Main/New York: Campus.
Hobbes, Thomas (1959). Vom Bürger. In: ders. (1959): Vom Menschen. Vom Bürger (2. Auflage). Hamburg: Felix Meiner. S. 59–327.
Hobbes, Thomas (1998). Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen und bürgerlichen Staates. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Hobbes, Thomas (2010). Leviathan. Erster und Zweiter Teil. Stuttgart: Reclam.
Hobbes, Thomas (1991). Behemoth oder Das Lange Parlament. Frankfurt am Main: Fischer.
Hobsbawm, Eric (1972). Industrie und Empire I. Britische Wirtschaftsgeschichte seit 1750. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Horkheimer, Max/Adorno Theodor W. (2008). Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente. Frankfurt am Main: Fischer.
Krauthausen, Raul (2021). „Ich fühle mich nicht ausreichend geschützt“. In: ze.tt, https://www.zeit.de/zett/politik/2021-01/raul-krauthausen-risikopatient-corona-pandemie-impfstrategie-kritik (letzter Zugriff: 13.02.2021).
Macpherson, Crawford Brough (1973). Die politische Theorie des Besitzindividualismus. Von Hobbes bis Locke. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Marx, Karl (1976). Zur Judenfrage. In: Marx, Karl/Engels, Friedrich – Werke, Band 1. Berlin: Dietz. S. 347–377.
Marx, Karl (1967). Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. Wien: Europäische Verlagsanstalt.
Marx, Karl (1965). Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. In: Marx, Karl/Engels, Friedrich – Werke, Band 23. Berlin: Dietz.
Münkler, Herfried (1991). Thomas Hobbes’ Analytik des Bürgerkrieges. In: Hobbes, Thomas (1991). Behemoth oder Das Lange Parlament. Frankfurt am Main: Fischer. S. 215–238.
Münkler, Herfried (1993). Thomas Hobbes. Frankfurt am Main: Campus Verlag.
Stapelfeldt, Gerhard (2006). Der Merkantilismus. Die Genese der Weltgesellschaft vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Freiburg: ça ira.
Stapelfeldt, Gerhard (2012). Neoliberaler Irrationalismus. Aufsätze und Vorträge zur Kritik der ökonomischen Rationalität II. Hamburg: Dr. Kovač.
Stapelfeldt, Gerhard (2014). Aufstieg und Fall des Individuums. Kritik der bürgerlichen Anthropologie. Freiburg: ça ira.
[1] „Mittlerweile habe ich allerdings die Sorge, dass der Begriff ‚Risikogruppe‘ neu besetzt wird: als die Gruppe, die ein Risiko für die Wirtschaft darstellt. Aus CDU und vor allem FPD [sic] hört man immer wieder, man müsse die Risikogruppen schützen, um den Lockdown zu beenden. Da werde ich hellhörig, für mich heißt das: Wir müssen diese Gruppe also nicht schützen, um sie zu schützen, sondern damit die Wirtschaft und das ‚normale‘ Leben weitergehen können.“ (Krauthausen 2021, S. 2).
[2] Ich schreibe „im modernen Sinne“, da Hobbes an vielen Stellen durchaus von einem vorgesellschaftlichen Naturzustand schreibt, obwohl er lediglich von der Staatsmacht abstrahiert. Dies liegt daran, dass für Hobbes wie für viele andere seiner Zeit Gesellschaft nur als staatlich konstituierte vorstellbar war – ganz im Sinne der politischen Gesellschaft des Feudalismus.
[3] 1648 waren einer Schätzung Macphersons zufolge bereits ca. 50 Prozent der gesamten Bevölkerung lohnarbeitend, auch wenn nach Hill diejenigen, welche ausschließlich von Lohnarbeit lebten, im 17. Jh. noch in der Minderheit waren (Hill 1977, S. 121, S. 141; Macpherson 1973, S. 311–327).
[4] Zu deren Verwirklichung im Zuge der ersten englischen bürgerlichen Revolution: vgl. Hill 1977, S. 106, 115–119, 144f.
[5] Lediglich die besitzenden Klassen, zu welchen auch die aufstrebenden bürgerlichen gehörten, bestanden aus freien und zunehmend gleicheren Subjekten, welche in der Lage waren, sich gegeneinander zu vereinzeln. Sie waren die Subjekte des bellum. Lohnarbeitende, Versklavte und die Eingeborenen der Kolonien wurden stattdessen als Objekte von Herrschaft behandelt.
[6] Zu deren sukzessiver Beseitigung im Zuge der Ersten Bürgerlichen Revolution: vgl. Hill 1976, S. 130; 136
[7] Die Forderungen der Revolutionäre gingen freilich noch weiter. Nach Hobbes sei der Souverän nicht von der Benutzung des Privateigentums auszuschließen (vgl. Hobbes 1998, S. 191).
[8] Die historische Betrachtung beschränkt sich an dieser Stelle auf Großbritannien. Dies begründet sich einerseits darin, dass der Hobbessche Begriff des bellum auf englische Verhältnisse referiert. Andererseits entwickelte sich England in dieser Zeit zum Zentrum der bürgerlich-kapitalistischen Weltgesellschaft, welches als Pionier der Industrialisierung bis zum Ende des 19. Jh. die kapitalistische Weltwirtschaft dominierte.